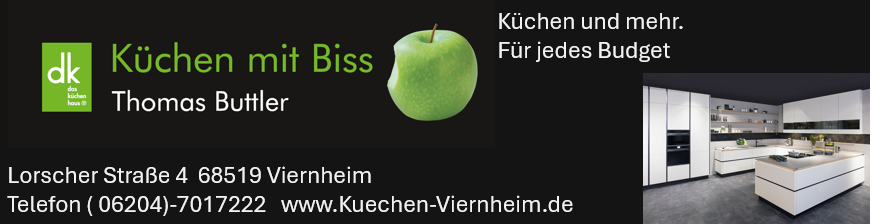AWO Familienzentrum: „Umgang mit Medien muss gestärkt werden“
Wilfried und Astrid Brüning sprechen auf Einladung des AWO Familienzentrums Kirschenstraße über Kinder im medialen Zeitalter


Viernheim (AWO Familienzentrum) – Digitale Medien sind aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Doch ein übermäßiger Medienkonsum kann sich negativ auf die Entwicklung von Kindern auswirken. Daher plädiert der Medienpädagoge Wilfried Brüning für einen bewussten Umgang mit und eine begrenzte Nutzung von digitaler Technik. Gemeinsam mit Ehefrau Astrid gestaltete er den Themenabend „Zwischen zwei Welten – Kinder im medialen Zeitalter“ im Treff im Bahnhof (TiB).
„Wir sind nicht gegen das Netz oder die Neuen Medien„, machte Wilfried Brüning gleich zu Beginn klar. Es gehe längst nicht mehr darum, dafür oder dagegen zu sein:„Es gibt kein Leben mehr ohne digitale Medien.“ Allerdings müsse der Umgang mit ihnen gestaltet werden. Die Basis für einen erfolgreichen Umgang mit digitalen Medien sieht Brüning in der realen Welt: „Nur wer lebenstüchtig ist, kann später auch medientüchtig sein.“
Mit einem ebenso simplen wie treffenden Beispiel macht er den Unterschied zwischen realem Erlebnis und Erleben über den Bildschirm deutlich. Dazu lässt er „Lukas“ aus dem Publikum eine Zitrone erforschen. Gleichzeitig erleben die übrigen Gäste im ausverkauften TiB das gefilmte Geschehen über eine Leinwand mit. Schnell wird deutlich, dass beim realen Erlebnis alle fünf Sinne – Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken und sogar Hören – an dem Prozess beteiligt sind. Ganz anders beim Konsum über den Bildschirm, wo mit dem Sehen und dem Hören gerade einmal zwei Sinne angesprochen werden. „Und die auch nur zu etwa 20 Prozent“, macht Wilfried Brüning darauf aufmerksam, dass sich die Wahrnehmung hier nur noch auf eine Richtung, hin zum Bildschirm, konzentriere. „Unsere Neuronen wollen arbeiten“, macht er auf die Erkenntnisse der Hirnforschung aufmerksam. Diese würden aber beim Medienkonsum kaum bis gar nicht angeregt – mit der Folge, dass sie verkümmern oder absterben. „Die kommen dann nicht wieder.“ Das anschauliche Beispiel mit der Zitrone ging noch weiter: Brüning lässt die Sinne und ihre Verknüpfung durch Spanngurte darstellen. Die Zitrone lässt sich auf dem Netz aus fünf Sinnen ganz einfach auflegen –„speichern“–, während bei dem Bildschirmkonsumenten mit nur zwei eingeschalteten Sinnen keine Chance besteht, die Zitrone darauf abzulegen. „Unser Gehirn arbeitet wie eine Zusammenhang-Suchmaschine“, erklärte Wilfried Brüning.
Die Neuronen darin speichern Informationen nicht nur, sondern vernetzen ihr Wissen in einem „Netzwerk der Sinne“. Beim Konsum über den Bildschirm werden dabei aber drei Sinne regelrecht abgeschaltet.„Abschalten“, so Brüning, werde häufig als Motivation beim Fernsehen genannt. Und genau das sei es auch – allerdings nicht so, wie es der Konsument eventuell wahrnehme. „Fernsehen ist die Tätigkeit, bei der Ihr Körper die wenigste Energie verbraucht“, so der Moderator weiter. Kindern solle der Umgang mit digitalen Medien nicht untersagt werden, sondern er solle begrenzt werden. Dabei sei es wichtig, digitale Medien im Zusammenhang mit der realen Welt kreativ zu nutzen. Als Beispiele führt Brüning das Fotografieren und Herstellen eines Fotobuches oder das Filmen und Schneiden von Videos an. Computerspiele dagegen nutzten das körpereigene Belohnungssystem gnadenlos aus. Die in der virtuellen Welt erzielten, leichten Erfolge führten zu einem in der Frequenz immer weiter steigenden Ausstoß des so genannten „Glückshormons“ Dopamin. Deshalb sei es wichtig, auf die virtuellen Erfolge der Kinder entsprechend zu reagieren, wenn diese über das Erreichen des 8. Level schier aus dem Häuschen geraten. „Ferngesteuerte Unterhosen“, wird Brüning drastisch. Wichtig sei, gegenüber den Kindern durchaus den Erfolg zu würdigen, aber klar zu machen, „es ist nur bedingt Dein Erfolg“. Dieser sei gar nicht möglich gewesen, wenn nicht ein Programmierer den Weg vorgegeben hätte. Ganz anders als bei den, durchaus mit Anstrengung und Geduld erlangten Erfolgen in der Realität, zum Beispiel beim Langlauf oder Toren im Fußballspiel. Auf dem realen Platz.
Für seine Eingangsthese hatte Brüning kompetente Referenzen. So würden Eltern im Silicon Valley, also der amerikanischen Herzkammer des digitalen Fortschritts, ihre Kinder in der Regel auf Waldorf-Schulen schicken, wo die sinnliche und nicht die virtuelle Wahrnehmung im Mittelpunkt steht. Menschen wie Bill Gates (Microsoft) oder der verstorbene Steve Jobs (Apple) hätten ihren Kindern nicht mal den Besitz eines Smartphones erlaubt, geschweige denn die Nutzung von Spielen, die ihre milliardenschweren Konzerne entwickeln.
Wie Jobs bei seinen Kindern plädiert auch Brüning für eine kontrollierte Bildschirmmedienzeit. „Wer begrenzt, macht alles richtig“, so der Referent, der als Vater theatralisch zeigte, dass er wohl weiß, mit welchen Auseinandersetzungen das verbunden sein kann. Aber dies sei die beste Voraussetzung, im „4.0-Zeitalter“ zu bestehen und Herr oder Frau über digitale Medien zu sein und sich nicht in ihnen zu verlieren. Verständlich sei, wie schwierig das falle, denn es fehle noch an einer klaren Haltung, einem Konsens zur Begrenzung in der Gesellschaft. „Sie und ich gehören zu den ersten Eltern, die das machen sollen.“ Eltern aber, die stolz rühmten, in welch jungem Alter ihre Kinder schon mit dem Smartphone umgehen können, bescheinigte er: „Zweijährige mit Smartphone bekommen Wisch-Kompetenz, sonst nichts“.
Immer wieder machte das Referenten-Paar – auch humorvoll und unter Einbeziehung der Anwesenden – anschaulich deutlich, welche Gefahren die unkontrollierte Mediennutzung birgt, wie sie die Konzentrationsfähigkeit senkt und welche natürlichen Suchtmechanismen des Menschen beispielsweise in Gang gesetzt werden können, die gerade Kindern in ihrer Entwicklung Schäden zufügen. „Nein, ich kaufe dir kein Nintendo, aber eine Flasche Whiskey kannst du haben“, machte Brüning drastisch deutlich, dass Videospiele mindestens ebenso große Suchtgefahr bergen wie der Alkoholkonsum. Virtuelle und reale Lernerfolge könne ein Kind nicht unterscheiden; das sei der Grund für Kategorisierungen in leichte, mittlere und schwierige Computer-Spiele: „Jeder wird belohnt.“
Bei aller Warnung vor unkontrolliertem Medienkonsum des kleinen und jungen Nachwuchses – ums Verteufeln ging es den Beiden nicht. Die Referenten erinnerten vielmehr unter der Devise Begrenzen und Erlauben an die positiven Aspekte neuer Medien wie Hörspiele, Musik, der Recherche im Internet oder auch, um Kreativität zu fördern. „Wenn das Kind als Paparazzi mit der Kamera 500 Bilder von Omas Geburtstag macht, wird die Medienkompetenz geschult“, warb Astrid Brüning dafür, Kindern neue Medien als ein Werkzeug zugänglich und begreifbar zu machen.