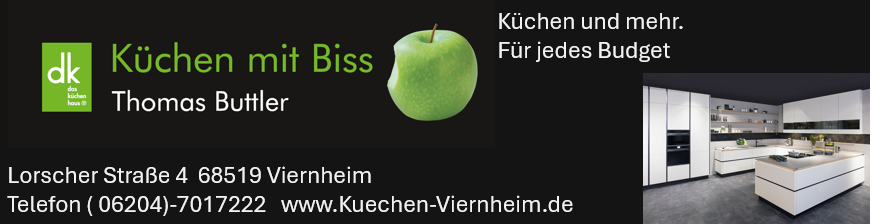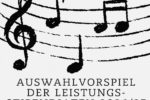Unsere Demokratie lebt von der Teilhabe der Bevölkerung – Interessanter Vortrag von Stefan Ackermann und lebhafte Diskussion bei der SPD

Weimar – Berlin: (SPD) – Parallelen und Unterschiede in der aktuellen Situation: Unter diesem Titel hatte die SPD Viernheim am 19.05.2025 ins Galicia (Bürgerhausrestaurant) eingeladen. Der Referent Stefan Ackermann ordnete im Laufe des Abends zahlreiche historische Dokumente in einer Bildpräsentation zeitgeschichtlich ein und zog Parallelen zum bundesdeutschen Parlamentarismus. Eine lebhafte Diskussion zu den Themen Stärkung der Demokratie, Einfluss der sozialen Medien und Verbot der AfD schloss sich an.
In Deutschland habe es im Unterschied zu anderen Staaten, beispielsweise Italien, nach Kriegsende eine breite Aufarbeitung des Faschismus und seiner Entstehungsbedingungen gegeben, stellte Co-Vorsitzender Peter Lichtenthäler bei der Begrüßung der rund 15 Zuhörer*innen fest. Das Thema sei im Geschichts- und Politikunterricht fest verankert und man habe jahrzehntelang in der Gewissheit gelebt, dass autoritäre, antidemokratische und rechtsnationale Einstellungen Randphänomene von begrenzter Dauer oder geringer Bedeutung seien. Die letzten Jahre hätten jedoch gezeigt, dass diese Gewissheit trügerisch gewesen sei.
Wir haben verkannt, wie wichtig es ist, einen kontinuierlichen gesellschaftlichen Diskurs über unsere Geschichte und die Grundwerte unserer Demokratie zu führen – und dass wir uns alle immer wieder – in konstruktiver Auseinandersetzung mit anderen – unserer eigenen Haltung vergewissern müssen.
Stefan Ackermann ist vielen Viernheimerinnen und Viernheimern als Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker durch seine Vorträge bekannt. Nur wenige wissen, dass er in den 1960er Jahren in Tübingen bei Klaus von Beyme und Theodor Eschenburg Politikwissenschaft studiert hat. Und schon war Stefan Ackermann im Thema, denn mit Eschenburg als ehemaligem Mitarbeiter des langjährigen Reichsaußenministers und DVP-Vorsitzenden Gustav Stresemann hatte er einen Politikprofessor mit profunden Kenntnissen über das politische Zentrum der Weimarer Republik.
Die Entstehungsgeschichte der ersten deutschen Republik, so Ackermann, reiche weit vor das Ende des Ersten Weltkrieges zurück: Sie wurde am 9. November 1919, also zwei Tage vor Kriegsende, ausgerufen. Die verfassungsgebende Nationalversammlung tagte vom 6. Februar bis 11. August 1919 nicht in der noch unruhigen Hauptstadt Berlin, sondern im namensgebenden Weimar in Thüringen. Damit war der erste Unterschied zwischen Weimar und Berlin mit der Ausgangssituation benannt: 1918/1919 entstand der Staat noch unter Kriegsbedingungen, 1949 nach einer ersten Konsolidierungsphase.
Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurden in den entscheidenden Verfassungsstrukturen die Lehren aus der krisenhaften Entwicklung der Weimarer Republik gezogen: Beim Wahlrecht, das mit einer Fünf-Prozent-Hürde eine Zersplitterung des Parlaments in Kleinparteien verhindern sollte, bei der deutlichen Machtbegrenzung des Bundespräsidenten gegenüber dem Reichspräsidenten, bei der herausgehobenen Stellung der Parteien in der politischen Willensbildung und (1956) bei der veränderten Rolle des Militärs. Im Unterschied zur Weimarer Zeit riskieren Parteien, die gegen die Demokratie agitieren, heute ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht („wehrhafte Demokratie“).
Bei allen Unterschieden zwischen Weimar und Berlin machte Ackermann aber auch eine Ähnlichkeit aus: die Bevorzugung nicht-demokratischer Parteien in der Endphase der Weimarer Republik mit dem heutigen Protestverhalten gegen das politische Establishment und einzelne Themen. Deshalb sei es ebenso wichtig wie die Diskussion um ein mögliches Verbot der AfD, dass sich die Zivilgesellschaft sichtbar für die Demokratie einsetze. Mit einem Zitat schloss Ackermann seinen Vortrag:
„Unsere Demokratie scheitert nicht wie in Weimar daran, dass es eine Demokratie ohne Demokraten wäre, sondern sie scheitert an der Gleichgültigkeit.“ (Kraske/Laabs, Angriff auf Deutschland. Die schleichende Machtergreifung der AfD, München 2024)
Die anschließende lebhafte Diskussion drehte sich vor allem um ein Thema: Wie kann die Bevölkerung motiviert werden, sich wieder mehr am politischen System zu beteiligen und für die Demokratie zu engagieren? Hier liege eine große Hoffnung in der Initiative „Viernheimer Appell“ mit ihren vielfältigen Aktionen. Der ehemalige Viernheimer Bürgermeister Norbert Hofmann beklagte den Nachwuchsmangel in den Parteien und plädierte deshalb dafür, vor allem junge Menschen mit vielfältigen Methoden zum Mitmachen zu bewegen. Dabei sollten vor allem die sozialen Medien stärker in den Blick genommen werden: „Wer nicht bei Insta oder TikTok ist, ist abgemeldet!“ Christian Inturri vom SPD-Parteivorstand sagte, man sei sich dessen bewusst und deshalb sei eine zentrale Strategie bei der aktuellen Neuausrichtung der Parteiarbeit die verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien.