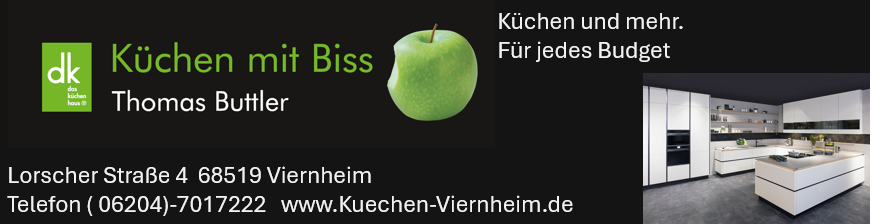Brundtlandbüro: 20 Jahre alte Solaranlagen – Wie geht es jetzt weiter?
Fachgespräch zur Zukunft alter PV-Anlagen im Rahmen des 20-jährigen Bestehens der Interessengemeinschaft Photovoltaik in Viernheim

Foto: Stadt Viernjeim
Viernheim (Stadt Viernheim) – Wie geht es mit den ersten Photovoltaikanlagen in Viernheim weiter, deren Einspeisevergütung nach 20 Jahren ausläuft? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Fachgesprächs anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Interessengemeinschaft Photovoltaik (IG PV). Im städtischen Museum kamen das Brundtlandbüro, Anlagenbetreiber der IG PV und Experten zusammen, um über Zukunftsperspektiven für ihre in die Jahre gekommenen Solaranlagen zu sprechen.
Gleichzeitig war das Treffen auch Anlass, das 20-jährige Bestehen der IG Photovoltaik selbst zu würdigen. Bürgermeister Matthias Baaß nutzte die Gelegenheit, um den engagierten Pionieren der ersten Stunde für ihren Beitrag zur Energiewende in Viernheim zu danken. Die IG habe nicht nur ihre eigenen Anlagen über zwei Jahrzehnte hinweg erfolgreich betrieben und kontrolliert, sondern ihr Wissen stets weitergegeben – etwa bei den Brundtlandfesten, bei denen sie regelmäßig Besucher über die damals noch neue Technologie informierten. Die Betreiberkenntnisse und Erfahrungen aus erster Hand kamen bei den Besuchern gut an.
Rückblick – Pionierarbeit in Viernheim
Im Sommer 2004 hatte das Brundtlandbüro erstmals zu einem Arbeitskreis Photovoltaik eingeladen. Daraus entstand eine Gruppe von etwa zehn engagierten Bürgern, die sich bis zum Bau ihrer eigenen Anlagen durch einen Fotovoltaikexperten fachlich beraten ließen und sich später zu einer Interessengemeinschaft zusammenschlossen. Initiatoren und Gründer waren Michael Falkenstein und Peter Krischker.
„2004 war die Welt der Photovoltaik noch eine ganz andere als heute“, berichtet Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow in seinem Rückblick. „Es gab in Viernheim gerade einmal 16 Anlagen. Und sie waren teuer. Etwa 5.000 Euro waren für ein Kilowatt Leistung der übliche Preis, was die Investition zu einem gewissen Wagnis machte. Rückblickend betrachtet haben sich die Anlagen als wirtschaftlich rentabel erwiesen. Das lag an der
Einspeisevergütung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die für 20 Jahre garantiert wurde, an der zuverlässigen Technik und daran, dass die Alterung der PV-Module (kristalline Zellen) zu viel weniger Ertragseinbußen führte, als angenommen.“
Damals war es der Rat des Experten, monatlich den Zähler abzulesen um zu prüfen, ob die Anlage noch arbeitet. Eine Überprüfung mit dem eigenen Smartphone, was heute Standard ist, gab es damals noch nicht. Und am besten verglich man seine Ertragswerte auch mit denen von anderen Personen mit ähnlichen Anlagen im näheren Umfeld, um festzustellen, ob die eigene Anlage vielleicht eine Minderleistung hat.
Dieses Kontrollsystem hat die IG PV professionalisiert und 20 Jahre durchgehalten. Monatlich bekommt Peter Krischker von allen Mitgliedern Mails mit den jeweiligen Monatserträgen. Er trägt diese Werte in Tabellen ein und schickt sie zurück. Damit konnte man seine eigene Anlage sozusagen eichen. Fällt die Abweichung zu anderen Anlagen zu hoch aus, ist das ein Grund für eine Prüfung. Der Aufwand hat sich gelohnt. Auf diese Weise bleiben technische Defekte wie Wechselrichterausfall, Leitungsprobleme und Ertragsabweichungen bei den Modulen maximal einen Monat unerkannt. Die regelmäßigen Kontrollen haben für alle zu einer Betriebssicherheit beigetragen. Was unspektakulär und nach viel Routine klingt war doch eine gute Absicherung für den wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der eigenen Anlage.
Was tun nach 20 Jahren Einspeisevergütung?
Für viele der damaligen Betreiber endet jetzt die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung und es stellt sich die Frage, wie man die noch funktionierenden PV-Anlagen sinnvoll weiter nutzt. Um diese Frage zu klären, war Hans-Georg Respondek von der Bürgersolarberatung Weschnitztal eingeladen. Er stellte vier Optionen vor:
- Weiterbetrieb als Volleinspeiseanlage
Die Anlage speist weiter Strom ins Netz ein, erhält dafür aber nur noch etwa 2,8 Cent pro Kilowattstunde – kaum wirtschaftlich. - Umbau zur Eigenverbrauchsanlage
Der produzierte Strom wird vorrangig selbst genutzt. Überschüsse gehen ins Netz – ebenfalls zu rund 2,8 Cent. Mit oder ohne Speicher eine attraktive Möglichkeit. - Repowering
Dabei wird eine neue, leistungsfähigere Anlage installiert. Sofern die alte EEG-Vergütung noch kurz weiterläuft, kann diese anteilig übernommen werden. Oft aber nur sinnvoll bei längerer Restlaufzeit. - Stilllegung und Rückbau
Die alte Anlage wird abgebaut. Eventuell wird eine neue Anlage aufgebaut.
In den meisten Fällen dürfte die zweite Variante, der Umbau zur Eigenverbrauchsanlage, die sinnvollste Variante sein. Die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie stellt mit „pv@now easy Ü20“ ein Online-Tool zur Verfügung, mit dem sich individuell beurteilen lässt, welche Option am meisten Sinn ergibt.
Hinweis zur Historie der Volleinspeiseanlagen
Die ersten PV-Anlagen in Viernheim waren sogenannte Volleinspeiseanlagen. Das bedeutet: Der gesamte erzeugte Strom wurde ins öffentliche Netz eingespeist, nicht selbst verbraucht. Betreiber erhielten dafür eine gesetzlich garantierte Vergütung über 20 Jahre – damals teils deutlich über 40 Cent pro Kilowattstunde. Diese Regelung hat maßgeblich zum Boom der Solartechnik Anfang der 2000er beigetragen.
Beratungsmöglichkeiten
Wer sich für eine eigene PV-Anlage interessiert, kann sich unabhängig und kostenfrei an die BürgerSolarBeratung wenden. Das Brundtlandbüro vermittelt gerne den Kontakt, telefonisch unter 06204 988-222.